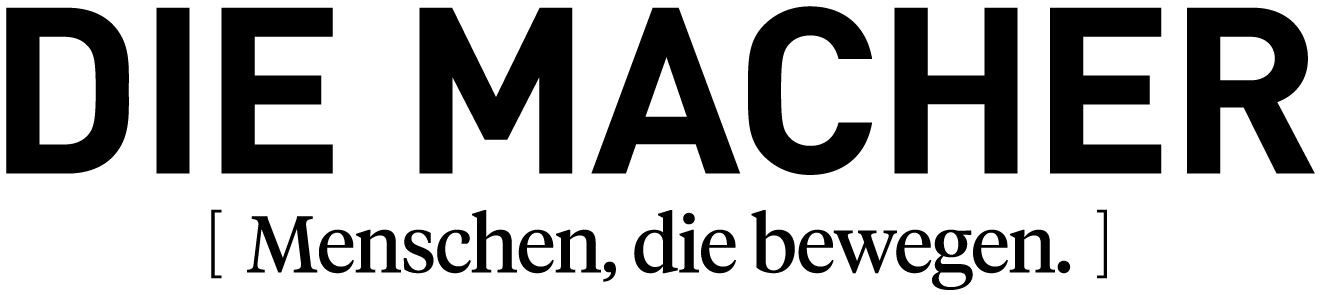Sozialer Survey 2021: Wie sich unsere Werte als Gesellschaft wandeln
Kürzlich wurden die Ergebnisse des Sozialen Survey Österreichs (SSÖ) 2021 präsentiert. Der Fokus lag dabei unter anderem auf der Untersuchung von sozialen Ungleichheiten in der österreichischen Gesellschaft und den Auswirkungen der Coronakrise auf die Werte der Österreicher:innen. Wir haben mit dem Studienkoordinator Dimitri Prandner von der JKU über die wichtigsten Ergebnisse gesprochen.
Was war für Sie das überraschendste Ergebnis des SSÖ?
Dimitri Prandner: Am überraschendsten war wohl, wie schnell die Bevölkerung in ihren Grundwerten und Grundeinstellungen auf die Coronakrise reagiert hat. Wertehalten werden in den Sozialwissenschaften normalerweise als relativ stabile Größe angesehen, die sich nur langsam verändern und adaptieren. Auch bei vergangenen Krisen wie der Finanz- und Wirtschaftskrise oder der Migrationssituation haben sich die Positionierungen der Österreicher:innen nicht allzu stark gewandelt. Die Coronakrise wirkte jedoch direkt auf die Kernaspekte der Werte. Viele Personen positionierten sich deutlicher was zum Beispiel das Thema Solidarität oder gesellschaftliche Teilnahme anbelangt.
Wie erklären Sie sich diesen Trend?
Dimitri Prandner: Wenn Menschen tatsächlich selbst von der Krise betroffen sind, entsteht offenbar ein rasches Umdenken. Die obengenannten Krisen trafen uns in Österreich nur peripher, Corona allerdings hatte konkrete Auswirkungen auf die Menschen. Vor allem beim Thema der Solidarität sind die Meinungen sehr auseinandergetriftet. Und wir haben festgestellt, dass die Solidarität mit vulnerablen Gruppen abnahm, je länger die Krise dauerte.
Sie haben sich auch mit den Zukunftserwartungen der Österreicher:innen beschäftigt. Zu welchen Ergebnissen kamen Sie in diesem Zusammenhang?
Dimitri Prandner: Generell sind Zukunftseinstellungen immer ein Indikator dafür, wie gut eine Gesellschaft funktioniert. Ein positiver Ausblick auf die Zukunft zeigt, dass das Zusammenleben gut klappt. Wir haben festgestellt, dass es durch die Krise einen starken Auf- und Ab-Trend gab. Am Beginn der Krise gab es einen großen Einbruch, ein Jahr später als die Impfversprechen kamen, sorgte dies wieder für optimistischere Zukunftsperspektiven. Mit dem Ausbruch der Omikronwelle hingegen sank das Zukunftsvertrauen wiederum. Es ist spannend, wie schnell sich dies in den vergangenen beiden Jahren immer wieder gewandelt hat.
Gibt es hierbei Generationenunterschiede? Wer blickt am positivsten in die Zukunft?
Dimitri Prandner: Es gibt hier zwei spannende Beobachtungen. Personen bis 25 sind positiver eingestellt als der Rest der Bevölkerung, weil sie davon ausgehen, dass die Situation wieder besser werden muss. Sie haben das Gefühl, dass sie jetzt wieder ihre Chance bekommen und dass sich der Arbeitsmarkt und das Bildungssystem wieder regulieren werden. Sie sind zwar auch enttäuscht, dass ihnen gewisse Möglichkeiten genommen wurden, aber sie spüren nun, dass sie wieder Handlungsoptionen erhalten. Im Gegensatz dazu sind die 25-29-Jährigen viel negativer eingestellt als die Gesamtbevölkerung. Für diese Gruppe fiel eventuell ihr Bildungsabschluss, ihr erster Beruf oder die Familiengründung in die Zeit der Pandemie. Bei ihnen ist der Frust darüber, dass sie den Umstieg ins Erwachsenenleben nur bedingt realisieren konnten, groß.
Welche Faktoren sind im eigenen sozialen Umfeld ausschlaggebend für eine positive Ausrichtung auf die Zukunft?
Dimitri Prandner: Hier spielen vor allem der Bildungsgrad und die Ressourcen, die man zur Verfügung hat, eine große Rolle. Wie ist man selbst verortet? Kommt man mit den eigenen finanziellen Ressourcen gut über die Runden? Wenn ja, ist man typischerweise optimistischer. Es gibt aber auch einen Geschlechterbias. Männer neigen dazu optimistischer zu sein, aber dies lässt sich oft durch eine Selbstüberschätzung erklären. Frauen sind hingegen realistischer und deswegen ein bisschen skeptischer. Auch das Alter spielt eine Rolle. Ältere Personen sind eher pessimistisch, Jüngere eher optimistisch, wobei es hier eben den oben beschriebenen Ausreißer Ende 20 gibt. Entscheidend ist auch immer das eigene Vertrauen in die Gesellschaft, das Sozialsystem und den Staat. Wer mehr vertraut, blickt optimistischer in die Zukunft.
Ein weiterer Fokus der Studie waren soziale Ungleichheiten und die Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs. Welche Trends lassen sich hier beobachten?
Dimitri Prandner: Es zeigt sich hier ein sehr spannender, langfristiger Trend. Die soziale Mobilität in Österreich ist immer weniger ausgeprägt. War in den 80er Jahren ein sozialer Aufstieg noch leichter möglich, können die Jungen heutzutage im Vergleich zu den Eltern oft keinen Aufstieg mehr realisieren. Das langjährige Versprechen von Bildungsexpansion löst sich somit immer seltener ein, was auch zu Frust bei jungen Personen führt. Wir befinden uns zwar noch nicht in einer Abstiegsgesellschaft, aber in einer Situation der Immobilität, in der wir langsam zum Stillstand kommen. Dies kann insofern ein gefährlicher Trend sein, als dass er auch einen Einfluss auf den Selbstwert von einzelnen Menschen hat.
Vor allem bei älteren Personen stieg durch die Coronakrise das Interesse an Politik. Warum?
Dimitri Prandner: Ältere Personen waren während der Coronakrise auffällig oft im Fokus der politischen Diskussion. Es wurde beraten, wie wir Ältere schützen können. Es ging immer deutlicher um das Gesundheitssystem, gewisse Förderungen und die Vulnerabilität dieser Gruppe. Somit entstand ein Diskurs, der normalerweise sehr limitiert ist. Wenn ich nun selbst im Fokus des Interesses stehe, entwickle ich auch selbst ein größeres Interesse für Politik. Darüber hinaus ist die ältere Bevölkerung auch jene Schicht mit oft niedrigeren Bildungsabschlüssen. Somit war auch das Ausgangsniveau für das Interesse an Politik geringer und konnte stärker ansteigen.
Haben Sie einen Zusammenhang beobachtet zwischen dem Interesse für Politik und den Zukunftserwartungen?
Dimitri Prandner: Ja, es ist tatsächlich so, dass jene, die sich nicht so sehr für Politik interessieren, ein positiveres Bild von der Situation haben als jene, die sich intensiv damit auseinandersetzen. Wir sprechen hier von einem gewissen Wahrnehmungsbias beziehungsweise einem Information-Gap. Wenn mir die Informationen fehlen, kann ich die Situation weniger gut einschätzen und beschäftige mich weniger mit den Konsequenzen.
Welche Ergebnisse des SSÖ erachten Sie als besorgniserregend für die Zukunft?
Dimtri Prandner: Ich finde keines der Ergebnisse wirklich besorgniserregend. Auffällig ist nur die Spaltung in der Gesellschaft, die wir schon seit knapp 20 Jahren beobachten. Die Drastik dieser Spaltung wurde durch die Coronakrise befeuert und es kam zu richtigen Grabenkämpfen zwischen Ideologien. Das haben wir vor der Pandemie nur bedingt beobachtet. Darüber hinaus verläuft die Spaltung nicht mehr an traditionellen Trennlinien wie der politischen Ideologie. Wir müssen diese Trennlinien also neu denken. Wir brauchen neue Modelle, Theorien und Kategorie und müssen darüber nachdenken, wie und warum sich die Gesellschaft im Moment spaltet. Vor allem, wenn wir uns wünschen, dass Personen, die unterschiedliche Vorstellungen haben, wieder miteinander kommunizieren.
Details zum Survey
Der SSÖ entstand durch die Kooperation mehrerer österreichischer Universitäten. Soziolog:innen der Universitäten Graz, Linz, Salzburg und Wien konzipierten gemeinsam die Umfragen. Den SSÖ gibt es bereits seit 1986, dieses Jahr fand er zum sechsten Mal statt. Die nächste Datenerhebung ist für den Sommer 2023 geplant. „Wir hoffen, bis dorthin dann schon zu einer Post-Corona-Gesellschaft forschen zu können“, erklärt Dimitri Prandner.