Einen Coworkingspace stellt man sich eigentlich anders vor: herumliegende Essensreste, halbleere Colaflaschen, dutzende Schreibtische in einem Raum. Doch hier sieht’s eher aus wie in einer schicken Agentur, sehr aufgeräumt, sehr schönes Design, sehr ruhig, sehr moderne Meetingräume. Aber die Söhne eines Industriellen, der über 5.200 Mitarbeiter beschäftigt und mehr als 1,5 Milliarden Umsatz erzielt, könnte man sich auch anders vorstellen. In chronischer Partylaune zum Beispiel, mit etwas höher getragenen Nasenspitzen. Clemens und Alex Pierer strecken hingegen nicht ihre Nasen in die Höhe, sondern krempeln ihre Hemdsärmel hoch, als sie uns im Workspace in Wels freundlich begrüßen. Kurz darauf kommt auch ihr Vater, Stefan Pierer, zur Tür herein. Und plaudert zunächst mit Barbara Mörtenhumer, die für die Organisation des Workspace verantwortlich ist. Ob er in zwei Wochen beim Wuzelturnier hier im Workspace mitmache, fragt sie ihn. Da sei er leider im Ausland. Ihre Frage war aber keine rhetorische – immer wieder nimmt sich Pierer Zeit, mit den Mietern des Coworkingspace Erfahrungen auszutauschen.
Die Mieter in den zwei Stockwerken hier im WDZ 9 in Wels sind meist Einzelunternehmer aus unterschiedlichen Branchen. Einer davon ist Xaver, selbstständiger Webentwickler. Er hatte zunächst einen Schreibtisch im Großraumbüro gemietet und ist nun in ein kleines, sehr helles Einzelbüro übersiedelt. „Das war meine Chance, weg vom Homeoffice zu kommen“, erzählt er. Seit Sommer 2016 werden im Workspace Wels schnell und unkompliziert Büros vermietet, denn Gründer und Unternehmer hätten es ohnehin nicht leicht in Österreich, sind sich die Pierers einig. Die Miete beträgt daher pro Quadratmeter inklusive Leistungen wie Empfang, Besprechungsräume, Business Events, geräumiger Küche, Betriebskosten, Internet, regelmäßiger Reinigung und hochwertiger Ausstattung 20 Euro. Und ist jederzeit kündbar. In einem der Büros sitzt Alex Pierer, er hat die Projektleitung für den Workspace über und erarbeitete gemeinsam mit seinem Bruder Clemens das Konzept dafür. Nicht weit von hier hat Clemens sein Fotostudio, schaut aber immer wieder gern auf einen Kaffee im Workspace vorbei. Heute geht’s weniger um den Kaffee, sondern darum, selbst mal vor der Linse zu stehen. Allerdings muss alles sehr schnell gehen – in maximal eineinhalb Stunden solle bitte alles fertig sein, wird uns im Vorfeld mitgeteilt. Nachdem unser Fotograf in 30 Minuten die Bilder im Kasten hat, geht’s rauf in den dritten Stock zum Interview. Die Küche ist riesig, hochmodern in schwarz, in der Ecke der besagte Wuzeltisch. Wir nehmen zu viert am Tisch in der Mitte Platz. Und aus eineinhalb Stunden werden drei. Und aus einem Interview wird ein emotionales Gespräch mit einem Vater, der stolz auf seine Söhne ist, obwohl oder gerade weil diese keine Kopien von ihm sind. Zwischen zwei Generationen, die unterschiedliche Voraussetzungen für ihre Karrieren vorfanden. Stefan Pierer ist ein Vertreter der klassischen Gründergeneration: „Ich hab von meinen Eltern eine gute Ausbildung mitbekommen und einen kleinen Rucksack, um daraus etwas zu machen“, erzählt der Industrielle, dessen Firmengruppe Pierer Industrie AG unter anderem im Segment Motorräder sowie im automotiven High-Tech-Komponentenbereich tätig ist. Bekanntestes Unternehmen der Gruppe ist KTM. Für seine Söhne war es damit kein kleiner Rucksack, sondern ein ganzes Imperium, das sie zum Karrierestart vorfanden. „Unter so einem großen Baum den eigenen Weg, die eigene Sonne und damit die eigene Erfüllung zu finden, ist nicht einfach“, so Stefan Pierer. Umso glücklicher sei er, dass beide fündig geworden sind. Und am Ende des Tages dieselben Werte wie er am meisten schätzen: Gesundheit und Familie.
Warum sieht es hier so anders aus als in typischen Coworking-Spaces?
Stefan_Ein klassischer Open-Workspace ist anders, da haben Sie recht. Ich beschäftige mich schon einige Jahre mit der Gründerszene in Österreich – man muss natürlich unterscheiden zwischen einer Stadt mit Universitäten und einer Provinzstadt wie Wels. Hier haben wir viel mehr Jungunternehmer als Start-up-Gründer. Diese Leute wollen effizient in getrennten Einheiten arbeiten und suchen dennoch persönliche Vernetzung in gemeinsamen Zonen.
Alex_Es gibt nicht wie in einer Großstadt den Bedarf, tageweise einen Platz zu mieten, es geht bei uns vielmehr darum, Jung- und Kleinunternehmern ein professionelles Umfeld zu bieten, um etwa vom Homeoffice wegzukommen. Deshalb gibt es hier auch mehr abgeschlossene Räume, weniger Freiflächen als üblich.
Clemens_Ähnlich wie in einem klassischen Start-up-Büro kommt es aber auch hier zu persönlichen Vernetzungen – man lernt jemanden kennen, der fachliche Bereiche abdeckt, die man selbst nicht hat. Das ist wichtig, um wachsen zu können.
Stefan_Und das ist ja der Hemmschuh des Gründers: das Einstellen der ersten Mitarbeiter.
Alex_Wir versuchen, ein Klima für ein gutes Miteinander zu schaffen, sodass die Mieter größere Projekte gemeinsam abwickeln können.
Stefan_Und deshalb sieht’s hier nicht aus wie in einer Partyzone, wie man’s etwa von Coworkingspaces in Wien kennt. Dort herrscht dann die Einstellung, dass man jetzt eine tolle Idee hat, die einem jemand abkauft und dann wird man so reich wie Zuckerberg. Ein völliger Irrglaube!
Wird der Begriff Start-up denn zu sehr gehypt?
Alex_Der Begriff Start-up ist zweischneidig. Zum einen trägt er dazu bei, das Unternehmertum in Österreich positiver zu besetzen. Und das ist immens wichtig – in Amerika sind doppelt so viele Menschen bereit, sich selbstständig zu machen wie in Österreich. Die zweite Seite ist aber, dass der Begriff Start-up oft mit der Vorstellung eines Lottogewinns einhergeht – das Ziel, dass man irgendwann den großen Exit macht. Damit habe ich ein massives Problem, weil das mit Unternehmertum nichts zu tun hat. Wenn ich etwas nur großmachen will, um mich dann zu vertschüssen, ist es nichts Nachhaltiges. Das ist einfach nur Lottospielen. Das gelingt vielleicht fünf Unicorns, der Rest sind Jungunternehmer. Und für die ist es sicher nicht von Vorteil, wenn der Eindruck vorherrscht, dass man eine Idee hat, die man schnell vermarkten und großmachen soll, um sie dann möglichst schnell zu verkaufen. Arbeiten und etwas zu erschaffen kann ja etwas Erfüllendes sein.
Stefan_Das ist genau auf den Punkt getroffen! Unternehmertum heißt Versuch und Irrtum, gepaart mit viel Einsatz und Fleiß. Und nicht Lottospielen.
Kann nicht der Wunsch nach viel Geld der Antrieb für diesen Fleiß sein?
Stefan_Und dann? Was macht man nach dem Exit? Geld ist nur ein Wertespeicher, ein Mittel zum Zweck. Aber beim Unternehmertum geht es um etwas ganz Anderes – irgendetwas wirklich zu unternehmen, größer zu werden und letztlich stehst du im Wettbewerb. Und genau dieser Wettbewerb hält dich frisch. Natürlich, wenn du eine entsprechende Liquidität zur Verfügung hast, kannst du größere Dinge unternehmen, aber es geht immer darum, dass du Freude an dem hast, was du als Unternehmer machst. Ich bin überzeugt, dass man nur dann Erfolg haben kann. Und deshalb kann der Handwerker, der sich selbstständig macht und damit seine Erfüllung findet, genauso erfolgreich sein. Dazu muss mir meine Idee nicht irgendeiner aus dem Silicon Valley abkaufen und dann gehe ich auf die Insel.
Sie hätten schon Mitte der 90er Jahre auf die Insel gehen können, weil Sie damals bereits ausgesorgt hatten.
Stefan_Unternehmertum ist wie bei einer mechanischen Uhr die Unruhe. Die gibt nie eine Ruhe. Geld bedeutet natürlich schon auch Freiheit, wenn du eine soziale Ebene erreicht hast, wo du keine Sorgen haben musst, ob du deine Miete bezahlen kannst, und gibt eine enorme Sicherheit. Aber es ist die Freude an der Gestaltung, die Freude, etwas aufzubauen und Verantwortung zu übernehmen.
Haben jüngere Generationen nicht mehr diese Freude an der Gestaltung und an der Verantwortung? Investoren beklagen, es gebe zu wenige Projekte, die sie fördern könnten.
Stefan_Wir haben in Österreich definitiv einen Mangel an Unternehmensgründungen. Weil das Unternehmertum keinen positiven Stellenwert hat. Das Risiko, selbstständig zu werden, tun sich viel zu wenige an. Wir haben keine Gründerkultur in Österreich.
Warum?
Stefan_Leistung muss Freude machen. Zum einen brauchst du die Selbsterfüllung, den Spaß an dem, was du machst. Und zum anderen muss diese Leistung auch in der Gesellschaft anerkannt werden. Und am Ende des Tages muss es sich auch lohnen. Diejenigen, die bereit sind, mehr zu leisten, sollen belohnt werden. Heute ein Unternehmen in Österreich zu gründen, ist nicht einfach – Stichwort Bürokratie, Vorschriften, Arbeitszeitregelungen und all diese Dinge. Bei einer derart hohen Besteuerung stellt sich für junge, engagierte Karriereleute schon die Sinnfrage: Warum mache ich das überhaupt?
Mit dem Workspace möchten Sie dennoch viele zum Gründen motivieren. Warum lohnt es sich trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen, Unternehmer zu sein?
Stefan_Unternehmertum heißt Freiheit. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als selbstbestimmt entscheiden zu können. Das ist meine Erfüllung, egal wie viel Mühe dahintersteckt.
Welche Rolle spielt das Alter beim Gründen?
Clemens_Ich glaube, eine große. Wenn man jung ist, geht man viel unbedarfter an die Sache heran und hat meist noch nicht die große Verantwortung einer Familie gegenüber.
Wobei Sie schon auf der Welt waren, als Ihr Vater Unternehmer wurde.
Stefan_Ja, das stimmt. Meine Frau und ich hatten das Glück, sehr früh Eltern zu werden. Wenn man eine Familie mit zwei Kindern hat, bedeutet das natürlich, dass man die Entscheidung zur Selbstständigkeit gemeinsam trifft, sonst brauchst du das nicht machen.
Alex_Aber ich finde, die Entscheidung, zu gründen, ist immer gleich mutig, egal mit welchem Alter.
Was haltet ihr davon, gleich aus der Uni heraus zu gründen?
Stefan_Ich glaube, das ist zu früh, weil die Berufserfahrung fehlt. Wir sehen das bei vielen Start-ups, die direkt nach dem Studium gestartet haben. Da fehlt dir schon ein bisschen der Zugang und das Verständnis des Marktes.
Alex_Das Problem vieler Start-ups ist, dass sie oft eine Schieflage im Spektrum ihrer Fähigkeiten haben – drei Techniker finden sich, einer ist wirtschaftlich affiner, der andere ist Programmierer, der dritte kümmert sich um die Hardware. Das reicht aber nicht, um sinnvoll ein Unternehmen am Leben zu erhalten. Es geht schlussendlich um die Menschen, ob so etwas erfolgreich wird oder nicht. Die Idee alleine ist nicht das Erfolgskriterium. Aber wenn ich mich an meine Uni-Zeit zurückerinnere, glaube ich trotzdem, dass es funktionieren kann, zu dieser Zeit zu gründen – dann, wenn es gelingt, die einzelnen Fachbereiche viel mehr miteinander zu vernetzen.
Tinder für Gründer?
Alex_(lacht) Man kann das auch vonseiten der Fakultät betreiben, indem man zum Beispiel interdisziplinäre Kurse anbietet. Klar bedarf es einer Umstellung, aber ich glaube, die Kommunikationsfähigkeit ist immens wichtig. Diese Skills, die man im Beruf braucht, die kriegst du oft nicht durch eine Fachausbildung an einer Universität, sondern erst im Beruf selbst. Trotzdem kann eine Gründung von der Uni weg funktionieren.
Stefan_Meine unternehmerische Karriere hätte ich nicht direkt nach der Uni machen können. Nach meiner technischen, betriebswirtschaftlichen Ausbildung wollte ich den Verkauf in der Praxis lernen und bin als Assistent der Geschäftsleitung im Vertriebsbereich eingestiegen. Das Unternehmen war ein ganz schwerer Sanierungsfall, das habe ich aber auch erst gemerkt, als ich dort war. Und in solchen Fällen bekommst du sehr früh Führungsverantwortung. Mit 25 Jahren wurde ich Vertriebsleiter, verantwortlich für 70 bis 80 Leute. So lernt man, wie Management funktioniert. Entweder gehst du oder du schwimmst. Und nach einigen Jahren fühlte ich mich fit, mit einem Partner zusammen unser eigenes Ding zu machen.
Wie kamen Sie zu dem Partner?
Stefan_Er war der Geschäftsführer dieser Firma. Ohne diese Erfahrung im Beruf wäre ich nicht diesen unternehmerischen Weg gegangen. Unsere Start-up-Idee von damals war, Unternehmen günstig zu kaufen, wenn sie halbpleite oder schon pleite sind, diese dann zu restrukturieren und teuer zu verkaufen.
Ihr Sohn hat vorhin gesagt, der Begriff Start-up werde oft mit Lottospielen verwechselt. Aus Ihrer Idee wurde dann aber dennoch so etwas wie ein Lottogewinn.
Stefan_Da gebe ich meinem Sohn zu 100 Prozent recht: Ein Start-up zum Erfolg zu führen ist keine Lotterie, sondern viel Fleiß, Mühe, Versuch und Irrtum. Und: nie die Flinte ins Korn werfen! Dann kommt der Selbstantrieb und dann läuft’s.
Alex_Und jeder Erfolgsschritt motiviert, weiterzumachen. Aber es ist harte Arbeit!
Die könntet ihr beide euch theoretisch ersparen. Und trotzdem lehnt ihr euch nicht zurück. Was treibt euch an?
Alex_Es war lange für mich nicht denkbar, im Unternehmen meines Vaters mitzuwirken – also denkbar schon, aber der Glaube daran, darin gestaltend so mitzuwirken, dass es für mich erfüllend ist, daran hab ich zunächst gezweifelt. Weil mir die Authentizität sehr wichtig ist und mir anfangs nicht klar war, wo mein Zutun anfangen und aufhören kann. Klar, ich kann jetzt irgendwo ans andere Ende der Welt ziehen, tabula rasa machen und von vorne beginnen, um dieses Gefühl „Das ist mein alleiniges Werk“ zu erhalten. Aber mir kam schließlich die Erkenntnis, dass das auf’s Gleiche hinauslaufen würde. Mit dem Unterschied, dass die Gestaltungsmöglichkeiten in dem Umfeld, das ich hier vorfinde, wesentlich vielfältiger sind und ich mehr bewegen kann, als wenn ich von vorne beginne.
Dazu braucht es aber eine gute Vater-Sohn-Beziehung, oder?
Stefan_Man muss ihm die Freiheit lassen. Es ist sein Leben, er kann bestimmen. Egal, was er gemacht hätte, ich hätte es akzeptiert. Erstens sind meine Söhne sehr eigenständige und selbstbestimmte Menschen, und zweitens: Ich habe natürlich einen sehr großen Schatten geworfen mit dem, was ich geschaffen habe. Für die nächste Generation ist es dann nicht einfach, einen Weg außerhalb dieses Schattens zu finden. Aber den hat er gefunden. Auf eine unheimlich verstärkende Art und Weise, weil er die Zukunftsthemen in der Gruppe vorantreibt. Dazu braucht man – das muss ich ganz offen und ehrlich sagen – die nächste Generation. Und dabei kann er vieles bewegen.
Was genau möchten Sie bewegen?
Alex_Wir haben einen sehr offenen Dialog darüber, wie es mit dem erschaffenen Unternehmen nach Stefan Pierer aussieht. Die Zielsetzung ist, daran weiterzuarbeiten, das ist ein fortlaufender Prozess. Und da gilt es sicher an vielen Orten im Unternehmen, die Organisation auch zu verändern. Aber – und das ist für mich extrem wichtig – die Kultur zu erhalten, von der halte ich sehr viel. Das ist etwas, das wir beide von unserem Vater mitbekommen haben: die Bereitschaft, das Risiko anzunehmen. Wenn man zwei, drei Schritte in einem Thema drin ist, dann ist man viel schlauer, als wenn man davor steht.
Stefan_Ich habe viele Familiengesellschaften miterlebt und habe Dinge gesehen, die gut laufen und die schlecht laufen. Meine beiden Söhne sind aktiv im Unternehmen, Alex mit seinen Zukunftsthemen natürlich aktiver. Wir haben also gemeinsam in der Familie die Aufgabenstellung, weiter zu denken – unabhängig davon, was in drei Jahren ist. Daher ist es wichtig, dass sie die Leute in Führungspositionen kennen, das muss ja auch beziehungstechnisch passen. Wir diskutieren die Themen sehr offen und sehr intensiv – ihrer beider Meinung ist mir wichtig, weil sie eine sehr gute Einschätzungsqualität in der Menschenbeurteilung haben.
Clemens, Sie haben auch nicht immer den einfacheren Weg gewählt – für Ihre Diplomarbeit „Das friedliche Atom“ sind Sie in die Todeszone von Tschernobyl gereist. Braucht es solche Mutproben, um weiterzukommen?
Clemens_Es war ein einschneidendes Erlebnis und ging ziemlich an die Substanz. Nicht nur wegen der Strahlengefahr, vor allem auch wegen der dort herrschenden sozialen Konflikte. Danach kehrt man mit Demut und Respekt nach Hause zurück und ist froh, dass man in einem friedlichen Land lebt. Beruflich hat mich diese Erfahrung insofern weitergebracht, weil die dort entstandenen Bilder ein wichtiger Teil meines Portfolios sind. Diese Reise ist ein Benchmark für mich und hat mich sehr geprägt. Vor allem auch, weil ich über meinen eigenen Schatten gesprungen bin und den Mut hatte, eine Idee zu verfolgen, von der ich jahrelang besessen war. Ich glaub, diese Besessenheit hat mir die Kraft und den Mut gegeben, das auch durchzuziehen. Und das kann man auf alle Lebensbereiche umlegen – was man wirklich will, das schafft man auch. Mein Vater hat mir das so vorgelebt – man muss seine eigene Leidenschaft finden, über Jahre perfektionieren und dann ist es egal, ob Wochenende ist oder nicht – man hat einfach Spaß an dem, was man macht. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht.
Und machen damit etwas ganz anderes als Ihr Vater.
Clemens_Es wurde nie von uns verlangt, innerhalb der Gruppe weiterzumachen. Ich erinnere mich, dass der Papa davon erzählt hat, dass er in den 90er Jahren öfter sanierungsbedürftige Familienunternehmen erlebt hat, wo die Erbfolge festgeschrieben war und die deswegen den Bach runtergegangen sind. Der Alex hat das für sich als Ziel entdeckt, aber ohne Zwang.
Stefan_Ich bin froh und auch stolz, dass sie sehr bescheiden geblieben sind und mit beiden Beinen im Leben stehen. Ich blicke sehr positiv in die Zukunft.
Gab es im Laufe Ihrer Karriere Momente, in denen das Positivdenken verdammt schwer fiel?
Stefan_In über 30 Jahren vergisst man vieles, aber die Finanzkrise habe ich mir schon gemerkt. Und die werde ich mir sicher bis an mein Lebensende merken. Über Nacht ist alles hinuntergefallen, man wusste nicht, wie weit geht’s noch runter, der Kapitalmarkt war tot, die Banken waren am Ende und dann hast du die Verantwortung für Tausende Leute. Das war eine harte Zeit.
Was haben Sie daraus gelernt?
Stefan_Dass man eine möglichst hohe Eigenkapitalquote haben sollte, um bankenunabhängig zu sein. Obwohl ich dazu sage, dass sich damals vor allem unsere Regionalbanken hier in Oberösterreich unheimlich professionell und korrekt verhalten haben. Manche aus der Wiener Szene nicht. Das merkt man sich. Also unnötige Abhängigkeiten ab einer bestimmten Größe sollte man vermeiden.
Welche Erfahrungen können Sie noch weitergeben?
Stefan_Just do it! Oder im Volksmund: Probieren geht über Studieren. Wenn du’s nicht probierst, weißt du nicht, ob es funktioniert.
Alex_Ich glaube, eine gute Methode ist auch, wenn man sich fünf Jahre in die Zukunft denkt: Würde man’s dann bereuen, wenn man’s nicht versucht hätte? Wenn man ständig mit dem Gedanken spielt, die Fähigkeiten dazu hat und sich ausrechnet, dass man sich das leisten kann, dann sollte man’s versuchen.
Wie stellen Sie sich die Welt in 30 Jahren vor?
Clemens_Es wird unheimlich spannend! Ich glaube, wir werden Chips implementiert haben, das Gesundheitswesen wird sich stark weiterentwickelt haben, viele Berufszweige werden nicht mehr existieren und viele neue werden kommen.
Stefan_Diese Veränderungen werden eine Herausforderung sein. Aber so viel sich auch verändert, ich bin ganz sicher, dass es in 30 Jahren immer noch einen Verbrennungsmotor geben wird – der aber fast sauber ist. Und ich glaube an die Brennstoffzelle anstatt umweltzerstörender Lithium-Ionen-Batterien. Davon bin ich als Techniker überzeugt! Der momentane Elektro-Hype ist ein Irrweg – in Nischen angewandt, also bei leichten Fahrzeugen in der Stadt wie Fahrrad, Roller und Motorrad, natürlich absolut sinnvoll. Alles andere ist Schwachsinn.
Warum Schwachsinn?
Stefan_Weil der Gesamtzusammenhang nicht betrachtet wird: Wie wird der Strom weltweit erzeugt? Und warum kommt dieser dann in eine Batterie, die eigentlich ineffizient ist? Und das Thema Feinstaub! Sie müssen wissen, dass nur dreizehn Prozent davon vom Motor kommen, den Rest verursachen die Reifen und die Bremsen. Also ist die Elektromobilität reiner Schwachsinn – Medien und Politik machen da ihren Hype daraus, weil sie selbst keine Ahnung haben und naturwissenschaftlich ungebildet sind. Das ist ja genau das Problem: Wir haben zu wenige MINT-Absolventen, die Dinge wie das Ohm’sche Gesetz beherrschen.
Alex_Ich glaube, der Grund, warum Elektromobilität in der Gesellschaft so gut ankommt, ist, weil jeder etwas gegen die Verschmutzung der Erde tun möchte – auf den schmutzigen Verbrenner zu verzichten, scheint die Lösung zu sein. Aber diese Bereitschaft der Bevölkerung, den Planeten zu retten, sollte anders genutzt werden. Ich finde die Technologie grundsätzlich gut und glaube, dass wir Akkus nie wieder aus den Autos verlieren werden. Sie werden kleiner werden, aber nicht primär das Fahrzeug antreiben. Ich finde es schade, wie diese Technologie jetzt instrumentalisiert wird. Es geht vielmehr darum, dass wir unser Mobilitätsdenken verändern und uns von dem Gedanken lösen, dass jeder seinen PKW hat und von A nach B fährt. Dann brauchen wir in Bezug auf Elektromobilität auch nicht mehr die Diskussion über Reichweiten führen, was ja absurd ist, weil das nicht die Stärke des Elektroantriebs ist. Ach ja, und zum Thema „Die Welt in 30 Jahren“: Sie ist facettenreich, prosperierend und besser.
Inwiefern besser?
Alex_Weil ich daran glaube, dass die Menschen dazu verdammt sind, sich weiterzuentwickeln, so wie das ganze Universum eine einzige Evolutionsmaschine ist._

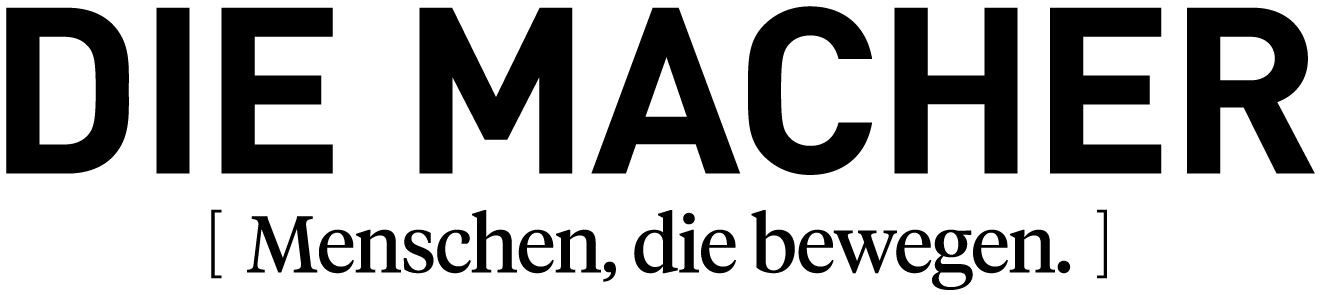













 PR
PR





 PR
PR









