Wie beurteilen Sie die Investorenszene in Österreich?
Wiesauer_Wir haben in Österreich eine sehr gute Angel-Investorszene. Es gibt viele aktive, vermögende Privatpersonen. Bei traditionellen Investoren wie Fonds ist Österreich halbtot bis tot.
Polgar_Es sind drei Teile zu unterscheiden: Der erste Teil des privaten Eigenkapitals, das entweder von den Gründern oder vom unmittelbaren Umfeld zur Verfügung gestellt wird, und der zweite Teil der öffentlichen Hand funktionieren sehr gut. Der dritte Teil der institutionellen Investoren hinkt nach. In Oberösterreich wurden in den vergangenen zehn Jahren auf der halböffentlichen und eher politik- und inkubatoren-getriebenen Ebene sehr viele Projekte begleitet, aber diese konnten nach ein, zwei Jahren in der Wachstumsphase nicht mehr genug Geld auftreiben. Das Erfreuliche ist, dass letzterer Teil nun dank vieler verschiedener Akteure endlich in Bewegung kommt und besonders auch im oberösterreichischen Zentralraum Aufbruchsstimmung herrscht. Von der Industrie bis zu den KMU wollen nun alle mit Start-ups kooperieren. Im Zuge der Digitalisierungsoffensive brauchen sie die Nähe zu den Start-ups. Es ist aber noch nicht klar, welche Akteure es gibt. Die Leute in unseren Beratungsgesprächen sind verunsichert bezüglich der Ansprechpartner.
Strugl_Ich schließe mich dem grundsätzlich an. Wir haben traditionell eine öffentliche Unterstützungsstruktur aufgebaut, da sind wir im Vergleich nicht schlecht. Privates Kapital – insbesondere Risikokapital – hat bei uns keine kultur-elle Verankerung, da sind wir unterentwickelt. In Asien werden Start-ups hauptsächlich öffentlich finanziert, in den USA hauptsächlich privat, in Israel beides. Das israelische Modell kommt am ehesten für Österreich in Frage: Die Unternehmen brauchen in der Frühphase öffentliche Hilfe in Form von Infrastruktur, Beratung und Kapital und später in der Wachstumsphase größere Beträge durch private Investoren. Jetzt wird das Thema in Österreich gehypt – auch von der Politik. Fast alles, was gegründet wird, wird als Start-up bezeichnet. Auch wenn die Stimmung dadurch deutlich besser geworden ist und sich langsam etwas zu entwickeln beginnt, müssen wir noch lange Wege gehen. Klar ist aber: Es gibt viel privates Kapital, es ist nur nicht gematcht mit den Ideen und nicht genügend angereizt.
Aichinger_Ich sehe das genauso. Es gibt sehr viel privates Kapital, es fehlen steuerliche Anreize. Das Thema Start-up ist in der Politik gut angekommen – eine Reihe von Vorzeige-Exits wie Runtastic, Mysugr oder Shpock haben ihr Übriges dazu beigetragen. Die ersten größeren Exits 2008/09 wurden noch nicht so ultra gehyped.
Wie sollten die angesprochenen fehlenden steuerlichen Anreize ausschauen?
Aichinger_Die Junge Wirtschaft fordert schon länger einen Beteiligungsfreibetrag. Bis zu 100.000 Euro an Investitionskapital sollen verteilt auf fünf Jahre als Freibetrag geltend gemacht werden können.
Wiesauer_Ich würde es so wie in England machen, wo man sich steuerfrei an Start-ups beteiligen kann. Und was noch viel besser ist: Wenn das Start-up einen Exit macht, dann ist der Erlös auch steuerfrei. Damit haben sie in England vor zwei Jahren einen unglaublichen Boom ausgelöst. Auch ein überhaupt nicht Start-up-affiner Bekannter von mir aus dem Management von IBM hat begonnen, in Start-ups zu investieren. Er musste dafür als „Schlipsträger“ in einem Konzern extrem umdenken. Wobei ich mir gleichzeitig gar nicht sicher bin, ob steuerliche Anreize so wahnsinnig wichtig sind, weil die Leute ja auch ohne diese investieren.
Aichinger_Der Exit muss nicht steuerfrei sein, man muss es ja nicht übertreiben. Wenn es wirklich einen Ertrag gibt, sollte dieser versteuert werden.
Wiesauer_Das wäre ein kleiner Turbolader, den man draufschraubt.
Achinger_Den Turbolader braucht man viel früher, in der Anfangsphase, um einen ersten Anreiz für ein Investment zu geben. Vergleichbar mit der Initiative „1plus1“, mit der man Ein-Personen-Unternehmen Anreiz und Motivation für die Einstellung der ersten Mitarbeiter gibt. Wenn ich einen Gewinn erwirtschafte, kann ich davon auch Steuern zahlen.
Wiesauer_Die Lohnnebenkostenförderung ist eh lässig. Dass ich einem Investor eine Förderung gebe, weil er in ein Start-up investiert, ist Unfug. Das Geld sollen die Start-ups bekommen.
Polgar_Der Fördergeber wollte damit auch ein Gefühl dafür bekommen, wo zurzeit investiert wird, und aus Sicht der Start-ups ist die Unterstützung doppeltes Kapital.
Gibt es neben den steuerlichen Anreizen noch andere Ideen, um der Investorenszene in Österreich Schwung zu geben?
Polgar_Wir müssen das Thema größer denken, dürfen uns nicht nur auf den Start-up-Bereich fokussieren und müssen für eine Bewusstseinsbildung der Mittelstandsfinanzierung sorgen. Eine Unternehmensfinanzierung funktioniert nur mit einer Mischung aus Geld von Banken und Eigen- sowie Wachstumskapital – Letzteres ist oft Risikokapital. Der Mittelstand ist teilweise zu stark bankenfinanziert, das führt zur Unbeweglichkeit bei Betrieben. Im Wachstums- und Innovationsbereich muss auch die alternative Finanzierung eine Rolle spielen. Je sensibler die Leute dafür werden und je mehr Start-ups mit KMU und Industriebetrieben zusammenarbeiten, desto mehr wird der Bereich geöffnet. Dann kommt die Investorenszene von selbst in Schwung, weil Geld und politischer Wille sind bereits da. Überhaupt sollte man den Leuten das Thema Unternehmensfinanzierung früher näherbringen. Oft setzen Gründer – von allen Unternehmen und nicht nur von Start-ups – ihr verfügbares Kapital völlig falsch ein und kommen dann nicht weit, ohne Haus und Hof verpfänden zu müssen.
Aichinger_Beim Thema Unternehmensfinanzierung ist auch wichtig hinzuzufügen, dass dies oft gar nicht mehr so risikoreich ist, weil Gründer das Geld meist erst in Wachstumsphasen brauchen, wo das Geschäftsmodell bereits erprobt ist. Unternehmen werden überwiegend mit Eigenkapital gegründet, Gründer tragen viel Risiko selbst. Als Maßnahme für eine Verbesserung der Investorenszene muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass ein Investment in Start-ups eine Alternative zu klassischen Anlegerformen ist. Viele Familienunternehmen mit genügend Kapital haben das noch nicht am Radar, weil sie das von früher nicht kennen. In der Nachkriegszeit, wo viele mittlerweile große, erfolgreiche Unternehmen aufgebaut wurden, war diese Finanzierungsform kein Thema. Ich weiß aber von traditionellen Familienunternehmen, dass bei ihnen der Gedanke an Start-up-Investments immer präsenter wird. Sie brauchen neben den fehlenden rechtlichen Rahmenbedingungen noch Zeit und Informationen. Ich bin vor kurzem von einem Unternehmer gefragt worden, wie er ein Investment von bis zu 30 Millionen angehen soll. Derzeit gibt es nicht viele aktive Investoren in Österreich, die so viel Investitionskapital übrighaben. Wir brauchen eine Art „Info-Events“ für potentielle Investoren, wo man erklärt, wie das abläuft.
Wiesauer_Das ist eine eigene Szene und Außenstehende haben da nicht so einfach Zugang. Startup300 bietet Firmen- und Family-Offices seit kurzem in Form von einem Sponsoring die Möglichkeit, in Start-ups zu investieren.
Strugl_Aufgrund unseres kulturellen Hintergrunds ist in Österreich manches anders als in anderen Industriestaaten. Das hat mit unserer Historie zu tun, wir sind stark auf den öffentlichen und institutionellen Sektor ausgerichtet. Was fehlt, ist Entrepreneurship Education. Eine Fremdfinanzierung mit Unternehmensbeteiligung ist weniger beliebt, lieber wollen viele Gründer Haftungen statt Beteiligungen. Da kommt Gott sei Dank jetzt Bewegung rein, in vielen Bereichen entsteht langsam ein anderes Mindset.
Laut Rudolf Kinsky, Präsident vom Private-Equity-Branchenverband AVCO, kommen öffentliche Förderungen in Österreich oft nicht bei den richtigen Projekten an. Das Förderwesen sei unorganisiert und es würden Start-ups gefördert werden, die es nicht verdient hätten. Ist diese Kritik berechtigt?
Aichinger_Die Kritik kann ich nicht nachvollziehen und ich lasse auch die immer wieder gehörten Klagen über den Förderdschungel nicht gelten, es gibt genug Beratungsmöglichkeiten. Solche Kritiken entstehen, wenn Leute für ihre Idee, die sie natürlich selbst als die coolste betrachten, nicht so viel Geld wie andere bekommen.
Polgar_Ich beschäftige mich seit knapp 15 Jahren mit dem Fördermarkt und traue mich, mit Überzeugung zu sagen, dass dieser noch nie so transparent wie jetzt war. Das heißt nicht, dass endgültig alles transparent ist, aber vor allem die öffentlichen Förderagenturen sind spitze. Kritik könnte es geben, weil es in den vergangenen Monaten einzelne Schwierigkeiten bei der Geschwindigkeit von Auszahlungen gegeben hat. Neutralität und Unabhängigkeit sind bei Finanzierung und Förderberatung für Start-ups elementar und das können halböffentliche und öffentliche Stellen sehr gut gewährleisten.
Strugl_Diese Neutralität ist für die Gründer wichtig. Unsere Inkubatoren werden genau dafür geschätzt. Unser OÖ Hightech-Inkubator tech2b ist der beste Inkubator Österreichs. Das hat die Evaluierung für das scale-up-Programm gezeigt.
Aichinger_Zur Vorphase möchte ich ergänzen: Es ist ganz wichtig, dass es in dieser Zeit kostenlose und nicht gewinnorientierte Stellen von der öffentlichen Hand gibt. Gerade in der ersten Phase sind die Gründer oft noch unschuldig und unbeholfen. Wenn jemand zum Beispiel nur 5.000 Euro braucht und an den Falschen gerät, gibt ihm dieser gleich 15.000 Euro für 30 Prozent der Firmenanteile. Das eigentlich gebrauchte Geld hätte er aber ganz einfach, etwa vom Wirtschaftsimpulsprogramm des Landes OÖ oder Gründerfonds, bekommen. Man muss aufpassen, die jungen Unternehmer nicht gleich zu verbrennen und ihnen mit vielen Anteilen die ganze Motivation zu nehmen. Das ist das Land den Gründern und Leistungsträgern, die sehr viel Risiko auf sich nehmen, schuldig. Ich weiß aus eigener Erfahrung von einem Start-up, wo ich mitbeteiligt bin und das im Tech2b-Gründerprogramm ist, dass das bereits extrem gut funktioniert.
Wiesauer_Ich helfe vielen Start-ups bei Förderanträgen. Diese sind transparent, die Beurteilung ist nachvollziehbar. Das Problem bei den öffentlichen Förderungen sind die knappen Geldmittel. Wenn die öffentliche Hand jährlich einige Millionen Euro für den PreSeed-Bereich hat und bis zu einem Höchstbetrag von 200.000 Euro in ein Gründerteam investieren kann, dann ist das für ein Land wie Österreich lachhaft. Israel hat 5.000 bis 7.000 aktive Start-ups, die für die ersten 24 Monate ein attraktives Funding haben. Von Israel wird alles nach Amerika ausgelagert, die haben eine Struktur in Kalifornien, bei der sie den Anschluss suchen, und eine Zweitrunde passiert automatisch.
Aichinger_In Israel haben sie andere Rahmenbedingungen, die nicht angenehm sind. Die haben keinen Markt und müssen ab der Sekunde nach der Gründung sofort in Übersee nach Kunden suchen. Wir vergleichen uns immer mit anderen Märkten, die wir mit den vielen Eigenheiten nicht kopieren können. Jeder im internationalen Umfeld lobt sich selbst, aber es ist in den anderen Ländern nicht automatisch alles besser. Wir haben so viel Industrie und so viele Unternehmen und dadurch Kapital sowie Nährboden – das fängt an bei Sicherheit und geht über das ganze Sozialsystem, wo sich Israel, Silicon Valley oder Berlin durchaus eine Scheibe abschneiden können. Wir haben damit einen entscheidenden Standortvorteil, die Szene muss in Österreich nur ins Laufen kommen. Man darf die eigene Ware nicht zu schlecht reden – natürlich gibt es Herausforderungen, aber die gibt es an jedem Standort.
Strugl_In Israel gibt auch die staatliche Agentur schon in der Gründungsphase große Summen. Aber die Start-ups müssen bald aus Israel weggehen, weil das Industrieumfeld fehlt und der Markt klein ist. Ähnlich ist das auch in Berlin. Wir haben wegen unseres Vorteils des starken industriellen Umfelds mit den Berlinern vereinbart, dass wir in diesem Bereich kooperieren können und daran sind sie interessiert. Entscheidend ist jetzt, dass ein Ökosystem entsteht und wir Kapital anziehen – ohne Letzterem bleiben wir bei diesen kleinen homöopathischen Dosen, die vielleicht aus dem öffentlichen Sektor kommen, und diese sind zu wenig.
Gibt es in Österreich überhaupt genug gute Projekte für potentielle Investoren?
Wiesauer_Als Fundraiser für Capital300 weiß ich, dass es in Österreich im internationalen Vergleich nur wenige gute Projekte gibt. Das liegt am Umfeld. Uns geht es sehr gut, wir sind satt, werden in der Schule in ein Gleichmachersystem reingedrängt und dazu erzogen, kein Risiko einzugehen und einmal ein braver Angestellter zu werden. In Amerika haben sie da eine ganz andere Einstellung, die sind hungrig. Bei uns ist die grundsätzliche Aufklärungsarbeit wichtig, dass man die jungen Leute dazu bringt, ein Risiko zu tragen und ein Unternehmen aufzubauen. An unserem Know-how scheitert es nicht.
Strugl_Das Bildungssystem muss in Richtung Wirtschaft offener werden, es soll mehr Verständnis für und Wissen über die Wirtschaft vermittelt werden. Manche Pädagogen machen das bereits hervorragend, bei anderen bemerken wir immer wieder eine Grundskepsis gegenüber neuen Ideen und anderen Herangehensweisen. Dafür braucht es eine Veränderung im System der Schulverwaltung. Zu mir hat einmal jemand aus dem Landesschulrat gesagt: „In meine Schulen kommt ihr nicht rein.“
Polgar_Die Wirtschaftskammer kooperiert seit Jahren mit der pädagogischen Hochschule, das Gründerservice bringt den Studierenden das Thema „Unternehmertum“ einen Tag lang näher. Da gehört natürlich noch viel mehr gemacht, aber damit ist schon ein großer Wurf gelungen, wenn man die angehenden Pädagogen für das Thema sensibilisiert. Es gibt auch einen bundesweiten Schulterschluss für weitere Kooperationen mit den pädagogischen Hochschulen. Ich sehe darin viel Potential.
Aichinger_Zur Frage, ob es überhaupt genügend Projekte zum Investieren gibt: Wenn wir mehr haben wollen, müssen wir etwas ändern. Wenn jemand eine höherbildende Schule besucht, danach einen Studienabschluss an einer praxisnahen Fakultät macht und dieser dann bei der eigenen Unternehmensgründung von allen mit einem schiefen Auge angeschaut wird, wurde in der Bildung etwas falsch gemacht. Mir ist es so gegangen, alle haben mich gefragt, warum ich keinen Dienstvertrag unterschreibe und mich damit für den sicheren Weg entscheide.
Wiesauer_In Österreich würde uns auch eine ordentliche Universität nützen. Die Stanford Universität ist im Silicon Valley und generell in Amerika der Motor. Google zahlt der Universität aus Dankbarkeit jährlich fünf Milliarden US-Dollar, weil sie ihnen die Leute ausbilden. Stanford hat in etwa das gleiche Bildungsbudget wie die gesamte Bundesrepublik Deutschland, es werden 14.000 Studenten von 14.000 Mitarbeitern betreut.
Ist das Ziel, dass wir die österreichischen Projekte in die Welt hinaustragen und international finanzieren? Oder ist das Ziel, dass wir österreichisches Kapital zusammenbringen, das die Projekte im Land finanzieren kann?
Aichinger_In Österreich gibt es genug Kapital und Potential. Wirtschaftlich betrachtet ist es für Österreich wahrscheinlich der beste Fall, wenn das Kapital hierbleibt.
Polgar_Das ist eine Entscheidung, die man nicht treffen kann, sondern die der Markt regeln wird und die Start-ups treffen. Wenn Gründer das Gefühl haben, dass sie hier Unterstützung bekommen und es eine funktionierende Infrastruktur gibt, dann ist die Chance höher, dass sie dableiben. Darum zahlt sich jede Initiative – egal ob privat oder öffentlich – in diesem Bereich aus.
Strugl_Die Frage kann man nicht eindeutig beantworten. Klar ist, wir wollen mehr heimisches Kapital mobilisieren. Ich bin aber auch nicht dagegen, wenn ein internationaler Investor in Österreich investiert. Wir haben etwa mit Dynatrace oder Runtastic genug Beispiele, die sich anders finanziert haben und hier weitermachen. Ab einer gewissen Größenordnung in der Finanzierung wird es natürlich immer schwieriger in Österreich und deshalb ist es ein primär wichtiges Ziel, mehr österreichisches Kapital in die Pipeline zu bringen.
Polgar_Ein Punkt, wo man auch sensibilisieren sollte, ist das Thema, dass immer gesagt wird, wie cool nicht alles in Amerika ist und wie cool nicht eine Beteiligung auf internationaler Ebene ist. Wir müssen den Leuten und den Start-ups vermitteln, wie interessant es sein kann, heimisches Kapital zu nutzen.
Wiesauer_Da reden wir glaube ich von zwei Paar Schuhen. Das Coole am amerikanischen Kapital ist halt der Kapitalgeber, der dahintersteht. Das sind Leute, die in der Regel nicht nur Kapital investieren, sondern auch einen Haufen Connections und Branchen-Know-how mitbringen. So etwas müssen wir bei uns entwickeln. Fünf Millionen Euro können wir jederzeit aufstellen – aber smarte fünf Millionen von einem amerikanischen Investor, da geht die Post ab.
Strugl_In den USA gibt es viel Erfahrung mit der Skalierbarkeit von Geschäftsmodellen, man ist agiler, aber auch risikobereiter.
Polgar_Das ist unstrittig, da will ich gar nichts dagegen sagen. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass es in Österreich 30.000 Gründungen gibt und das Potential im Bereich innovativer, skalierbarer Geschäftsmodelle in etwa bei 1,5 bis maximal 2,5 Prozent vom Gründermarkt liegt – da reden wir von ein paar Hundert.
Wie wichtig ist Cashflow für Investoren in Österreich im Vergleich zu internationalen Investoren?
Wiesauer_Das ist bei jedem Investor verschieden. Ich investiere sofort in eine Firma mit einer riesigen disruptiven Idee, wo es um ein User-basiertes Geschäftsmodell geht und die Gründer vielleicht gar nicht wissen, wie man damit Geld verdient. Insgesamt gibt es meiner Einschätzung nach sehr wenige cashflow-getriebene Investoren und es gibt auch nur wenig Start-ups, die wirklich gute Cashflows haben.
Aichinger_Runtastic zum Beispiel hat es in den ersten Jahren geschafft, Cashflow aufzubauen, indem es parallel Dienstleistungen in der App-Entwicklung angeboten hat und damit – so wie auch mit ihrem Kerngeschäft – sehr erfolgreich war.
Wiesauer_Das ist aber die Ausnahme. Man muss bei Start-up-Investments grundsätzlich davon ausgehen, dass alles doppelt so teuer wird und doppelt so lange dauern wird._

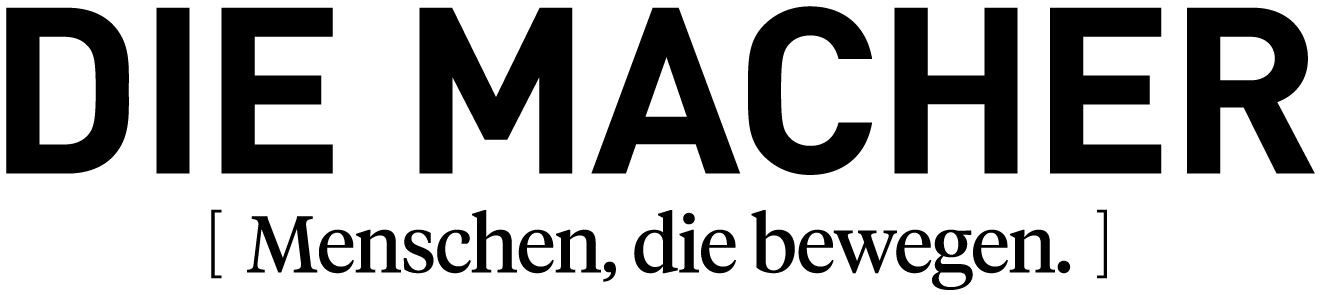
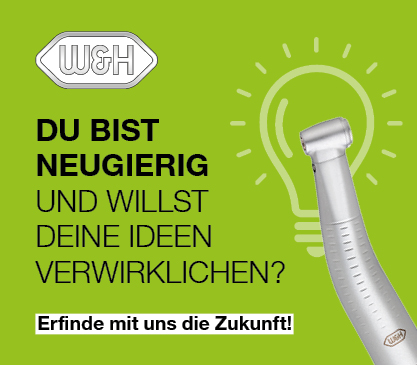








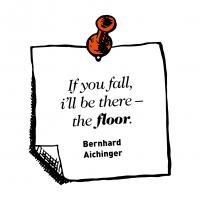

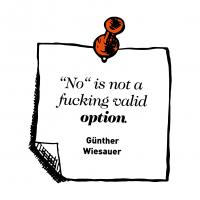



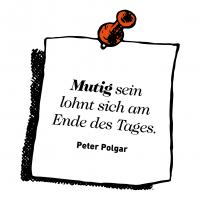

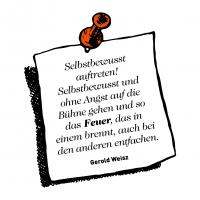












 PR
PR





