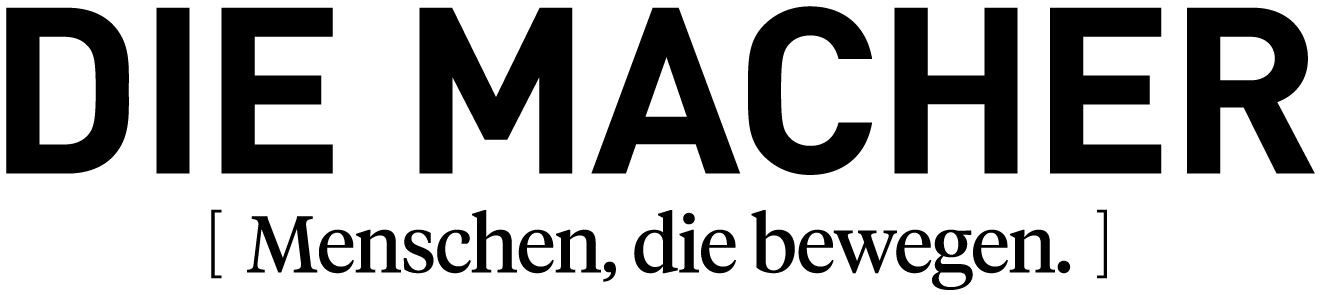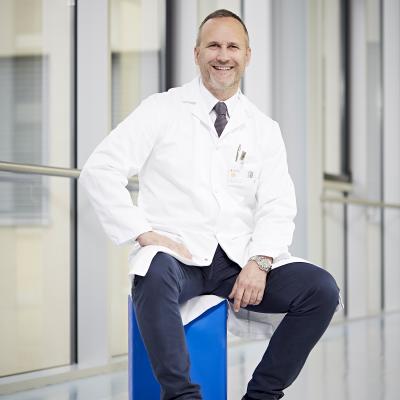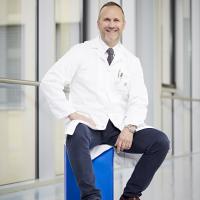Operationen am Herzen werden für den Patienten also immer schonender. Aber wie lebt es sich nach so einem Eingriff?
Binder_In der Therapie haben wir deutliche Fortschritte gemacht, vor allem auch in Bezug auf das Langzeitüberleben. Während vor zwanzig Jahren etwa ein Drittel der Patienten nach einem Herzinfarkt nach drei Jahren verstorben ist, sind es jetzt nur noch circa zwölf Prozent. Durch die moderne Therapie und die schnelle Behandlung des Herzens hat sich das Überleben im und auch nach dem Krankenhaus deutlich verbessert.
Zierer_Eine Herzoperation ist natürlich ein ganz einschneidendes Erlebnis für einen Patienten. Danach braucht es auch sehr viel Eigenverantwortung in Bezug auf Ernährung und Bewegung. Wir empfehlen unseren Patienten immer, eine dreiwöchige Kur zu machen. Dort gibt es Physiotherapeuten, Ernährungsberater und man trifft andere Patienten. In diesen drei Wochen hat man Zeit sich abseits des Alltags mit der Krankheit auseinanderzusetzen und dann für sich selbst einen Plan zu schmieden, wie man damit umgeht.
Wie fühlt man sich nach der Operation?
Zierer_Meistens können die Patienten drei, vier Tage nach der Operation wieder schmerzfrei auf dem Gang herumspazieren. Früher lag man da noch auf der Intensivstation.
Wie wird diese Entwicklung fortgeführt? Welche Forschungsschwerpunkte gibt es, was wird in Zukunft noch besser werden?
Zierer_Forschungsschwerpunkte sind die neuesten Generationen an Kathederklappen, die man entweder über die Leiste oder über die Herzspitze platziert. Außerdem gibt es viele Forschungsbestrebungen im Bereich der Kunstherzen. Im Falle einer Herzinsuffizienz, wenn das Herz schwächer pumpt und man im Endstadium nur noch die Hoffnung auf eine Transplantation hat, ist das Kunstherz eine Alternative. Das ist eine Pumpe, die einen Teil des Blutes durch den Körper pumpt, um dadurch das Herz zu entlasten.
Wird dieses Herz dann schon bald aus dem 3D-Drucker kommen?
Zierer_Ja, genau, das ist schon relativ nahe an der Realität. Zumindest Klappenvorlagen kann man schon im 3D-Drucker erstellen. Auf diesen Schablonen kann man dann Klappengewebe anzüchten. Ob man irgendwann ein ganzes Herz mit dem 3D-Drucker nachahmen kann, wird sich zeigen - ich halte es aber prinzipiell nicht für unmöglich.
Revolutionäres passierte bereits im Juli 2017 am Klinikum Wels-Grieskirchen: Erstmals in Österreich konnten zwei Herzklappen gleichzeitig in einem minimalinvasiven Eingriff behandelt werden.
Binder_Das ist ein weiterer Schritt in die Zukunft, wo es darum geht, mit immer schonenderen Methoden für die Patienten immer komplexere Eingriffe zu machen. Wir haben das Glück, hier in Wels/Grieskirchen in einem Krankenhaus auf internationalem Niveau zu arbeiten, wo wir sämtliche medizinischen Möglichkeiten haben und auch neue Entwicklungen aufgreifen und sie unseren Patienten anbieten können, um sie auf bessere sowie schonendere Weise zu behandeln. Ein wichtiger Punkt ist für mich, dass der Patient im Mittelpunkt der Behandlung steht und dass wir Patienten so behandeln, wie wir in dieser Situation selbst gerne behandelt werden möchten.
„Stress wirkt sich definitiv auf das Herz aus."
Ronald K. BinderLeiter der Abteilung für Kardiologie und Intensivmedizin am Klinikum Wels-Grieskirchen
Sie haben beide jahrelang im Ausland gearbeitet. Warum sind Sie jetzt hier in Oberösterreich?
Zierer_Weil wir mit dem Referenzzentrum nun das größte Zentrum für Herzchirurgie in Österreich haben, wo das komplette Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten angeboten wird. Somit sind wir auch bei Studien mit dabei und können die neuesten Behandlungsmethoden anbieten. Ich war immer an einer Uniklinik tätig, weil ich nicht nur selbst am Ball bleiben, sondern die Entwicklung mitgestalten will.
Herr Zierer, Sie sind ja auch Professor an der Medizinischen Fakultät der JKU. Wie erleben Sie dort die Medizinstudenten verglichen mit Ihrer Studienzeit?
Zierer_Es ist alles wesentlich persönlicher und familiärer, als ich es damals in Wien erlebt habe, wo zum Teil 1.500 Leute bei den Vorlesungen waren. Natürlich ist es nach wie vor ein anstrengendes Studium, in dem man viel lernen muss, aber durch kleinere Unterrichtsgruppen und besserer Strukturierung für praxisnahen Unterricht ist es aktuell effizienter und zielgerichteter als noch vor zwanzig Jahren.
Einige Ihrer Studenten streben wohl eine Karriere wie Sie an. Was würden Sie beide antworten, wenn man Sie fragt, wie das gelingen kann?
Zierer_Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, dass man Feuer und Flamme für diesen Beruf ist. Nur wenn man wirklich begeistert ist, scheut man auch keine Mühen. Man kann aber nicht alles von A bis Z durchplanen, es gehört auch ein Quäntchen Glück dazu, vielleicht auch Schicksal. Und es geht auch darum, so viele wertvolle Erfahrungen wie möglich zu sammeln, auch international. Ich bin von Wien weg nach Frankfurt gegangen und danach zweieinhalb Jahre in die USA. Dadurch gewinnt man auch wichtige Netzwerke.
Binder_Wichtig ist, dass man ein Ziel vor Augen hat, dass man hart daran arbeitet, aber dass man auch den Rest des Lebens nicht außer Acht lässt. Genauso wie mein Kollege finde ich, dass es von Vorteil ist, wenn man Erfahrungen an verschiedenen Orten sammelt. Ich selbst bin Österreicher, bin aber direkt nach dem Studium für 17 Jahre ins Ausland gegangen – vorwiegend nach Deutschland, Kanada und in die Schweiz, aber auch nach Afrika. Ich habe an verschiedenen Institutionen gearbeitet und da Methoden gelernt, die ich hier auch etablieren möchte.
Wenn Sie das österreichische Gesundheitssystem mit jenen, die Sie im Ausland kennengelernt haben, vergleichen – wie beurteilen Sie dann unseres?
Zierer_Selbst wenn wir nur ins Nachbarland Deutschland schauen, ist der Unterschied gravierend. Dort ist das System durch den wirtschaftlichen oder auch Gewinn-Gedanken in den Krankenhäusern geprägt. In Österreich ist es hingegen so, dass das Krankenhauswesen nicht dazu dient, Gewinn zu machen, sondern es gilt, Patienten bestmöglich zu versorgen und mit dem vorgegebenen Budget zurechtzukommen. In Deutschland verdient man als Krankenhaus sehr viel mit herzchirurgischen Eingriffen, weil Krankenversicherungen mehr erstatten als die tatsächlich entstandenen Kosten. Das heißt, je mehr man operiert, umso größer ist der erwirtschaftete Gewinn. In Österreich war das für mich eine 180-Grad-Drehung. Hier muss man als Abteilungsleiter mit dem vorgegebenen Budget zurechtkommen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es nicht im Sinne des Krankenhauses, möglichst viel zu operieren.
Welches System finden Sie besser?
Zierer_Mir persönlich ist das österreichische System sympathisch, weil der wirtschaftliche Gedanke eine weitaus kleinere Rolle als der medizinische spielt. In Deutschland ist man schon verleitet den Patienten immer die teuerste oder aufwändigste Therapieform zukommen zu lassen, diesen Anreiz gibt es in Österreich nicht. Und dann gibt es Länder wie Amerika, wo die Selbstbeteiligung viel höher ist. Da wird kein Achtzigjähriger mit dem Hubschrauber von zu Hause abgeholt, wenn er nicht vorher sein Haus verpfändet. Da ist die soziale Komponente in Österreich deutlich größer.
Binder_Ich finde auch toll am österreichischen System, dass jeder eine Krankenversicherung hat und man sich im Falle einer Krankheit keine Sorgen machen muss. Mein Appell an die Politik ist aber schon, dass man mit zu großen Sparmaßnahmen Acht geben sollte. Denn selbst wenn das System noch gar nicht verbessert wird, sondern nur auf dem Niveau bleiben soll, bräuchte es mehr finanzielle Mittel aufgrund der demographischen Entwicklung. Meine Hoffnung ist, dass die Gesundheitspolitiker mit entsprechender Weitsicht die Mittel zur Verfügung stellen und auch sinnvoll verteilen._