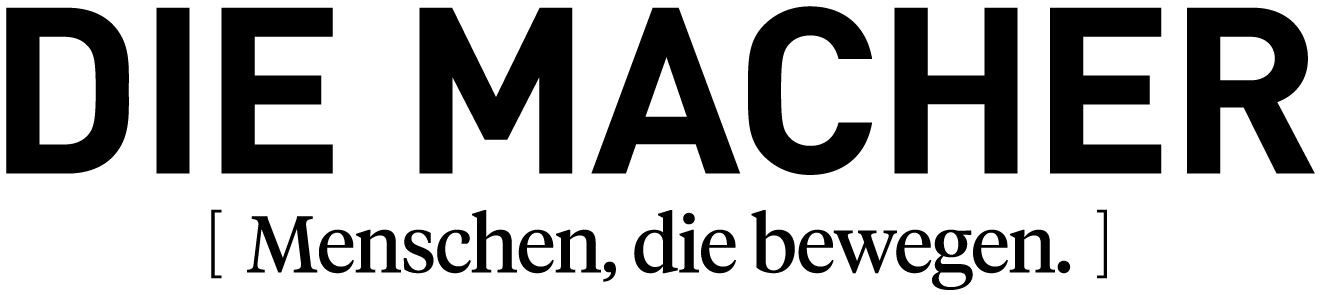Wissenschaftliche Ergebnisse werden in Europa oft nicht wirtschaftlich verwertet – sondern nur publiziert und diskutiert. Das ist wichtig, bringt aber kein frisches Geld in die Forschung. „European Paradox“ nennt sich dieses Phänomen, das im Software-Bereich besonders stark auftritt. Die langfristigen Folgen: die Gefahr der Nicht-Finanzierbarkeit in der Spitzenforschung und Nachteile gegenüber anderen Standorten. Welche Gründe gibt es für das Paradox – und wie kann das Problem gelöst werden?
Eigentlich hätte Europa das weltweite KI-Zentrum werden können. Stattdessen hinkt man bei der Integration der Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz klar hinterher, obwohl die Grundlagenforschung nach wie vor führend ist. Schon 1997 veröffentlichte der deutsche Informatiker Sepp Hochreiter gemeinsam mit Jürgen Schmidhuber eine Arbeit über Long short-term memory (LSTM). Die Technik ist zum wesentlichen Baustein der Entwicklung Künstlicher Intelligenz geworden – ohne sie wäre die Technologie heute wohl noch nicht so weit. LSTM-Technik ist in Google, Alexa und anderen Softwareprodukten integriert, damals erkannte noch niemand die Tragweite der Erfindung in Europa. Später erfand Hochreiter an der Linzer Johannes Kepler Universität „Self-Normalizing Networks“. Das Modell wurde nicht von europäischen Unternehmen, sondern zuerst von Amazon für Bewertungen und gezielte Werbung übernommen. „Damit haben sie binnen kürzester Zeit eine Milliarde Euro Umsatz mehr gemacht, als Dank habe ich bei einer Konferenz einen Mojito ausgegeben bekommen“, erinnert sich Hochreiter und lacht.
Europäer sind meist begeisterte Technologie-Enthusiasten. Die europäische Spitzenforschung erzielt in allen Gebieten herausragende wissenschaftliche Erkenntnisse und Ergebnisse. Das genannte Beispiel zeigt aber: Wirtschaftlich zahlt sich die Sache aber oft nicht aus. Die Universitäten und Forschungseinrichtungen sind und bleiben von öffentlichen Förderungen abhängig. Die Gründe dafür sind vielschichtig. „In Österreich spielen sich die „Kreisläufe“ von Forschung und Innovationen meist getrennt voneinander ab“, erklärt Markus Manz, Geschäftsführer des Software Competence Center Hagenberg. In der Forschung wird nahezu ausschließlich das technologische Problem adressiert, der Markt wird dabei meist außer Acht gelassen. So ist oft das Ergebnis eine Publikation oder ein Prototyp, der dann vielfach gar nicht für den Eintritt in den Markt positioniert wird. Das SCCH will das Problem angehen und den Technologietransfer von der Forschung in die Wirtschaft forcieren und dabei selbst auf Innovationen setzen.
Scouts, die nach Verwertbarem suchen?
Derzeit laufen Forschungsprojekte, die nicht direkt im Auftrag der Industrie passieren, hierzulande oft so ab: Nachdem Gelder für ein Projekt bewilligt wurden, beginnt die Forschung. Irgendwann ist die technologische Machbarkeit bewiesen, es kommt nach Publikationen zu Erwähnungen in renommierten Wissenschaftsmagazinen, möglicherweise auch zu einem Prototyp. Der technologische Erfolg, der vielfach beachtlich ist, ist das Ergebnis. Und dann – nichts. „Was aus den Ergebnissen danach wird, ist (noch) nicht in der DNA der europäischen Forschung. Nur in den seltensten Fällen wird der Markt, das Geschäftsmodell, die Innovation gleich mitgedacht“, sagt Manz, „es bräuchte Scouts, die zwischen Forschung und Industrie stehen und nach verwertbaren Ergebnissen suchen.“ Durch die fehlende Verwertung seien Forschungseinrichtungen und Universitäten kontinuierlich auf öffentliche Gelder angewiesen, die sonst beispielsweise durch Beteiligungen an neu gegründeten Unternehmen – sogenannte Spin-offs – lukriert werden könnten. Auch in Europa gibt es Beispiele, wie das funktionieren kann: So ist das Beteiligungsportfolio der ETH Zürich derzeit viele Milliarden Euro schwer.
Ein weiterer Grund für das Paradox ist für Manz das Mindset. „Wenn man in Tel Aviv oder im Silicon Valley Studierende fragt, wer von ihnen gründen will, melden sich die meisten.“ In Österreich hingegen würden die meisten einen risikoarmen, gut bezahlten Job in der Industrie bevorzugen. Auch Michael Haslgrübler, Area Manager im Bereich „Perception and Aware Systems“ bei Pro²Future, sieht das europäische Mindset als Erklärung für das Problem. „Wir tun uns hier in Europa schwer mit der Transition von wissenschaftlichen Ergebnissen zu vermarktbaren Innovationen, weil es an Risikokultur mangelt“, sagt er. Bestes Beispiel sei OpenAI mit ChatGPT. „Milliarden an Geldern sind dort vorab geflossen, ohne zu wissen, ob man irgendwas zurückbekommt.“
Das Forschungszentrum Pro²Future mit Sitz in Linz und Graz bringt KI in die industrielle Fertigung, man kooperiert mit mehr als 40 Industriepartnern und 30 wissenschaftlichen Einrichtungen und Instituten in Forschungsprojekten. Das COMET Forschungszentrum ist Schnittstelle zwischen Unternehmen und Wissenschaft und setzt damit direkt beim genannten Problem an. „Unsere Forschungsfragen sind von der Industrie inspiriert, Zielsetzung ist es, ein verwertbares Ergebnis zu erarbeiten“, erklärt Belgin Mutlu, Area Managerin im Bereich „Cognitive Decision Making“ bei Pro²Future. Unterstützung bei der Grundlagenforschung gibt es von Universitäten.
Wie funktioniert die Herangehensweise von Pro²Future? Haslgrübler: „Wir definieren gemeinsam mit Unternehmen eine Frage, mit der Zeit kommen weitere dazu, bis am Ende ein Prototyp entsteht, der auf Produktlevel gebracht wird und in der Infrastruktur des Betriebs zum Einsatz kommt.“ Dabei handelt es sich um mehrjährige Projekte. Wichtig sei eine realistische Erwartungshaltung. „Natürlich wissen europäische Unternehmen, dass man nicht gleich am nächsten Tag ein Produkt am Markt hat, wenn man mit der Forschung interagiert“, sagt Haslgrübler. Nachsatz: „Leider glauben manche, dass es am übernächsten Tag so weit ist.“ So funktioniere Forschung aber nicht – zumindest nicht bei Mitteln, die meist stark begrenzt sind. „Mache hoffen, dass sie mit einer Person, die sich vielleicht nur Teilzeit mit KI beschäftigt, Wunderwuzzi-artige Ergebnisse erzielen können.“ Um neue KI-Technologie möglichst schnell im eigenen Unternehmen zu integrieren, brauche es nicht nur Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem. „Es müssen auch unterschiedliche Disziplinen – von Softwareentwickler:innen über Mathematiker:innen bis hin zu Psycholog:innen vertreten sein“, sagt Mutlu.
„Wir werden das European Paradox für uns lösen“
Beim SCCH hat man sich hohe Ziele gesteckt – man will das European Paradox für sich lösen und zukünftig mit Forschungsergebnissen institutionalisiert Unternehmen gründen. „Wenn wir Erfolg haben, wird sich das hoffentlich herumsprechen und andere werden folgen. Wenn wir scheitern, haben wir viel gelernt und werden es weiter versuchen“, sagt Manz. Beispiel dafür, wie eine direkte Übersetzung von wissenschaftlichen Ergebnissen in Innovation funktionieren könnte, ist das geplante Spin-off „Birth.AI“: Gemeinsam mit dem KUK Kinderwunsch Zentrum am Kepler Universitätsklinikum wurde am SCCH ein neues Verfahren zur Unterstützung von Invitro-Fertilisation (IVF)-Behandlungen mittels KI entwickelt, „Birth.AI“ soll künftig als eigenes Unternehmen die Ergebnisse umsetzen. Thomas Ebner, Leiter des IVF-Labors am Kinderwunsch Zentrum, trat an das SCCH mit einer Idee heran, ein Modell zur Bewertung von befruchteten Eizellen (sogenannten Blastozysten) auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) zu schaffen. „Nach dem Training mit 600 Bildern war die KI in Teilbereichen schon so gut wie erfahrene Embryolog:innen, je mehr Daten desto unschlagbarer wird sie im Vergleich“, sagt Manz, der derzeit die Gründung vorantreibt.
„Birth.AI“ erzielte in jüngster Vergangenheit bereits einige Preise – davon kann man natürlich nicht leben. Seit Kurzem ist man auf der Suche nach Investoren. „In Israel gab es für eine ähnliche Technologe rund 30 Millionen Euro Investorengelder, das wird bei uns nicht klappen – aber technologisch auch dort wird nur mit Wasser gekocht“, sagt Manz._

Es mangelt an Risikokultur.
Michael Haslgrübler
Area Manager, Pro2Future

In Österreich laufen die Kreisläufe von Forschung und wirtschaftlichen Entwicklungen meist getrennt voneinander ab.
Markus Manz
Geschäftsführer, SCCH

Studierende können mittels KI Lösungen für komplexe Sortierprobleme erarbeiten.
Arno Bücken
Studiendekan, Campus Burghausen