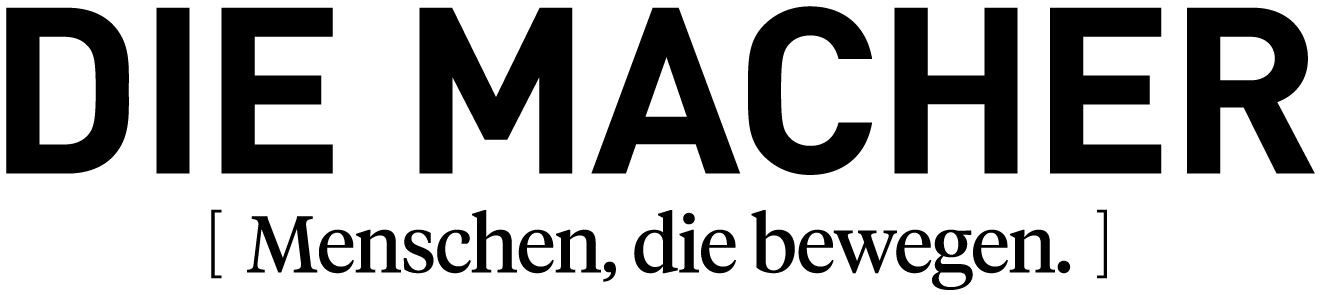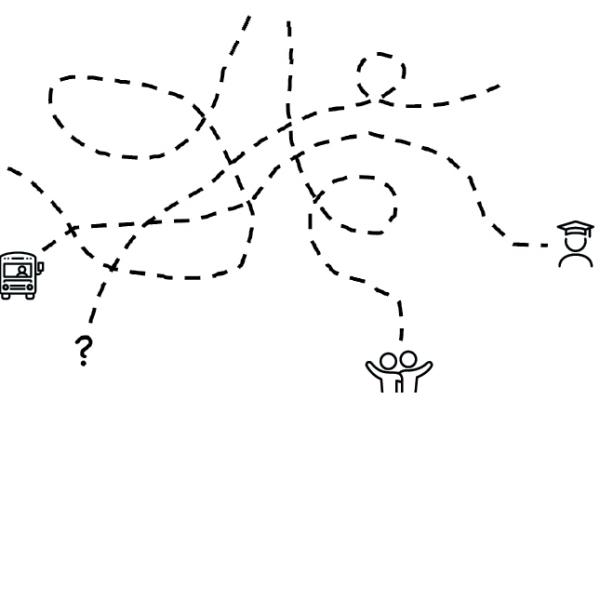„Schulen hatten jedoch noch nie die Aufgabe, Heranwachsenden bei der Entfaltung ihrer Potentiale zu helfen. In allen Gesellschaftsformen ging es darum, sie auf die Aufgaben vorzubereiten, für die sie später gebraucht wurden“, entzaubert Gerald Hüther dieses Wunschdenken. Als renommierter Neurobiologe übt der Vorstand der Akademie für Potentialentfaltung konstruktive Kritik an den Schwächen der Schul- und Bildungssysteme. „Es kommen schließlich genug junge Erwachsene aus unseren Schulen, die nicht wissen, was sie wollen, die kaum Gelegenheit hatten, sich ihrer eigenen Gestaltungskraft bewusst zu werden, deren Lust am Lernen und am Tätigsein weitgehend verloren gegangen ist und die sich deshalb sehr gut durch alle möglichen Angebote verführen und manipulieren lassen“, so Hüther.
Eine Frage des Systems
Ein entscheidender Fehler im Umgang mit der Schule, wie wir sie kennen, sei die immense Bedeutung, die wir ihr zuschreiben. „Wer oder was zwingt uns, die Schule so ernst zu nehmen, uns oft sogar zum Erfüllungsgehilfen ihrer verordneten Lehrpläne und Vorgaben zu machen und unsere Kinder und Jugendlichen auch noch selbst unter Druck zu setzen und sie am spielerischen Erkunden ihrer eigenen Möglichkeiten zu hindern, weil sie dafür gar keine Zeit mehr haben?“, hinterfragt Hüther den Status quo und spricht von einer Mücke, die zum Elefanten aufgeblasen wurde.
Während gesamtgesellschaftlich die negativen Stimmen gegen vermeintlich inkompetente Lehrkräfte immer lauter werden, geht der Hirnforscher mit den Betroffenen weniger hart ins Gericht. „Die meisten Lehrer:innen machen es so gut sie können. Sie brauchen unsere Unterstützung, denn sie sind größtenteils auch Opfer dieses Systems.“ Für den Experten stoßen viele von ihnen durch die derzeitigen Strukturen an die Grenzen ihres Schaffens. Es sei daher kaum verwunderlich, den natürlichen Impuls sowie den Grund dafür, warum man den Job einst ergriffen hat, allmählich immer mehr zu unterdrücken.
„Es bilden sich dann hemmende Nervenzellverschaltungen im Hirn und die unterdrücken die Vernetzungen, aus denen eigentlich Fürsorge und Aufgeschlossenheit entspringen“, erklärt der Neurobiologe. Schulen und damit auch die dort tätigen Lehrpersonen würde er aus diesem Grund von allem entlasten, was dort gar nicht geleistet werden könne. Bildung für ein gelingendes Leben würde so zur zivilgesellschaftlichen Aufgabe und müsste dort stattfinden, wo auch das Leben stattfindet, lautet Hüthers Vorschlag.
Wenn nicht mehr alles benotet werden würde …
… und Noten dadurch nicht mehr alles wären, würden die Bildungs- und Entwicklungsprozesse hinter den Zensuren eine neue Wertigkeit erfahren. Denn auf die Frage, ob Kinder Schulnoten bräuchten, gibt der Experte eine klare Antwort: „Wozu? Wer sie braucht, sind die weiterführenden Ausbildungseinrichtungen, also Berufsschulen oder Universitäten, die sich weigern oder zu faul sind, sich die geeigneten Bewerber:innen im persönlichen Gespräch selbst auszusuchen.“ Es könne ihm zufolge schließlich nicht sein, dass ein Notendurchschnitt darüber entscheidet, ob jemand Medizin studieren kann oder nicht. Wie sein direkter Vergleich mit Fahrschulen belegt, lernen dort auch Jugendliche mit schlechteren Schulnoten das Autofahren und die Verkehrsregeln. „Da ist die Frage: Was bringt sie dazu, das alles zu lernen, wo sie doch sonst so gut wie nichts lernen wollen? Und die Antwort ist ganz banal: In der Fahrschule ist die Person, die den Schüler:innen beim Lernen hilft, nicht gleichzeitig die Person, die sie prüft.“ Was er damit meint? „Lehrkräfte begleiten Schüler:innen dabei, zu lernen, wie etwa Fotosynthese funktioniert. Aber das Zertifikat, das das Wissen über die Funktionsweise der Fotosynthese bestätigt, das ist woanders abzulegen“, erläutert Hüther seine Idealvorstellung.
Für ihn ist diese Trennung ein echter Gamechanger. „Ist dies nicht der Fall, entsteht eine Haltung und die heißt: null Bock auf Schule. Was wir unseren Kindern aber eigentlich wünschen sollten, ist, dass sie positive Erfahrungen bei ihren Versuchen machen, sich in der Welt zurechtzufinden“, erklärt Hüther. Dabei gehe es weniger darum, Wissen abzurufen, sondern um Kompetenzerwerb – etwa die Fähigkeit, eine Handlung zu planen und die Folgen einer Handlung abzuschätzen, Impulse zu kontrollieren, Frust auszuhalten, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. „All das lässt sich aber nicht unterrichten, man kann dafür keine Schulstunde einführen. Sondern die Kinder und Jugendlichen müssen Gelegenheit haben, die Erfahrung zu machen.“ Für ihn steht daher fest: Die besten Lehrmeister, um herauszufinden, wie etwas geht, sind die Fehler, die bei diesen spielerischen Erkundungen immer wieder gemacht werden dürfen._