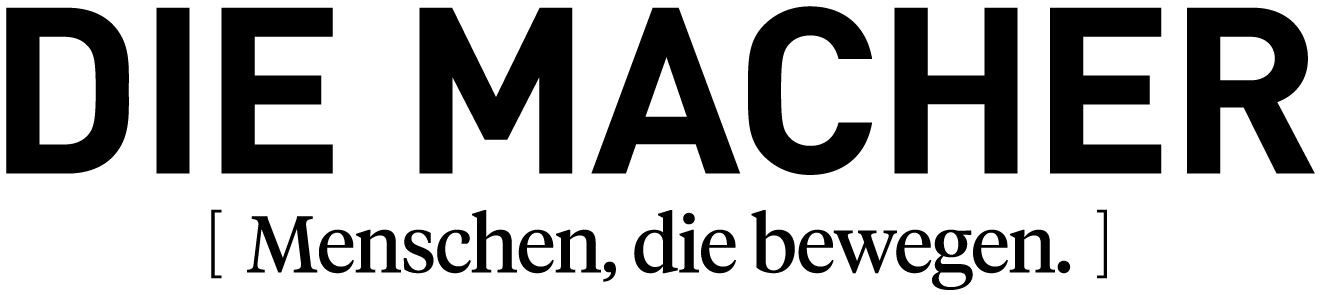Jeder zweite Arbeitsplatz in Oberösterreich ist vom Export abhängig. Über ein Viertel aller österreichischen Ausfuhren stammen aus Oberösterreich, dem führenden Exportbundesland. Doch wie hat sich die Coronakrise auf die Exportwirtschaft ausgewirkt? Und wie gelingt ein erfolgreiches Comeback? Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Oberösterreich, über einen erfolgreichen Restart, Zuversicht und Vertrauen und darüber, warum der Bauernmarkt am Südbahnhof nicht die Weltbevölkerung ernähren kann.

„Ohne globale Wertschöpfungsketten geht es nicht.“
Joachim Haindl-Grutsch
Geschäftsführer, Industriellenvereinigung
Welche Hürden meinen Sie und wie kann man diese am besten überwinden?
Haindl-GrutschAm Ende des Tages ist Wirtschaft Konsum. Für Konsum und einen globalen Rebound braucht man Zuversicht und Vertrauen. Die Politik hat nun die Aufgabe, für Bürger und Unternehmen ein „Zuversichtspaket“ zu schnüren, damit wieder investiert und konsumiert werden kann: Steuerliche Anreize, wie eine Steuerreform oder eine Senkung der Lohnnebenkosten lassen mehr Geld in der Geldbörse. Diverse Technologie- und Investitionsförderungen für Unternehmen kurbeln die Wirtschaft an. Durch Deregulierung und Bürokratieabbau können Projekte schneller umgesetzt werden und alles, was jetzt die Wirtschaft wieder knebeln würde und bei den Konsumenten zu Misstrauen führt, soll verhindert werden: Steuererhöhungen, Sparpakete oder etwa Investitionsbehinderungen von Unternehmen. Jetzt neue Steuern wie etwa Vermögenssteuern einzuführen, wäre fatal. Unsere wichtigsten Exportländer sind Deutschland, die USA, Italien und China. Wenn der internationale Personen- und Gütertransport wieder funktioniert und die Zuversicht der Menschen wieder da ist, dann läuft es wieder.
Bereits vor der Coronakrise verlangsamte sich das Wachsen der Exportwirtschaft in Oberösterreich. Als Gründe dafür wurden der Brexit, Handelskonflikte, Schutzzölle, die Nachwirkungen der Russlandsanktionen, CO2-Besteuerung und die Krise der Automobilbranche genannt. Wie schätzen Sie die Entwicklung von Handelsbeschränkungen durch die Krise ein?
Haindl-GrutschWir sehen anhand der Coronakrise, wie sehr unsere Wirtschaft global vernetzt ist und wie stark unser Wohlstand davon abhängt, dass die Weltregionen zusammenarbeiten. Schon vor der Coronakrise war klar, dass es Schieflagen und Ungleichgewichte im internationalen Handel gibt. Zölle sind von verschiedenen Regionen in unterschiedlicher Höhe auferlegt worden. Das hat viel mit der Historie von Regionen und Ländern zu tun. Heute begegnen wir uns auf Augenhöhe und deswegen muss man solche Schieflagen beseitigen. Es kann nicht sein, dass China wesentlich bessere Bedingungen hat als Europa oder die USA, die noch einmal schlechtere Bedingungen haben. Diese globalen Ungleichgewichte sind der Grund für Handelsstreitigkeiten. Deswegen wird diese Diskussion auch fortgesetzt werden müssen, weil die Alternativen Abschottung und neue Handelsbarrieren wären. Keiner würde das in der Post-Corona-Phase wollen.
Der Ruf nach mehr regionalen Produktionsstätten wird immer lauter. Wird die Krise langfristig zu einer Deglobalisierung führen? Was würde das für die Exportwirtschaft bedeuten?
Haindl-GrutschZugespitzt geantwortet: Vom Bauernmarkt am Südbahnhof kann man die Weltbevölkerung nicht ernähren. Die Globalisierung ist für unser gewohntes Leben unbedingt notwendig, Regionalisierungsträumereien sind der falsche Weg. Natürlich darf es dabei für einzelne Wirtschaftsregionen zu keinen einseitigen Abhängigkeiten wie beispielsweise bei der Medikamentenproduktion kommen. Aber es geht nicht ohne globale Wertschöpfungsketten, denn wenn wir etwa ein Auto zu hundert Prozent in Österreich bauen würden, wäre das natürlich für viele unbezahlbar. Regionale Vorteile der Globalisierung sind das Erfolgsgeheimnis unseres Wohlstandes, viele arme Länder sind durch die globale Vernetzung der Armut entkommen. Unser System beruht auf einer sozialen Marktwirtschaft, nur durch Exporterfolge können wir uns unser ausgeprägtes Sozial- und Gesundheitssystem leisten. Man sieht in dieser Krise außerdem deutlich, dass Staaten und Regionen, die in guten Zeiten Schulden abbauen und über gesunde Haushalte verfügen, in schlechten Zeiten durch ihre Reserven einen Vorteil haben.