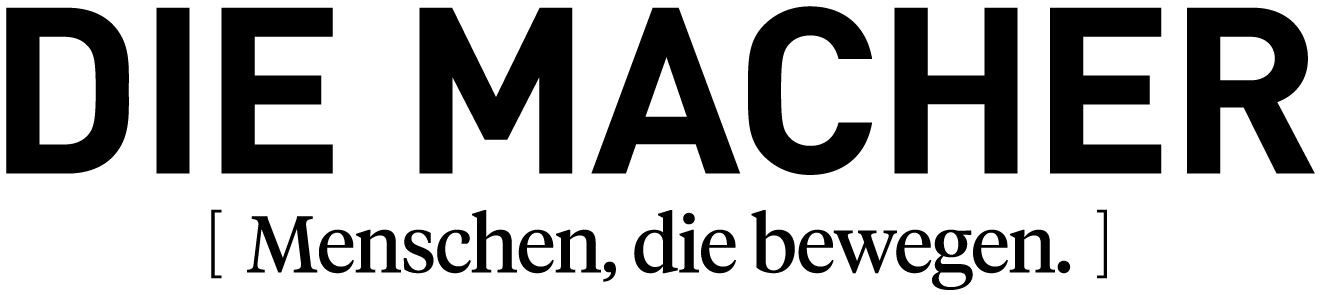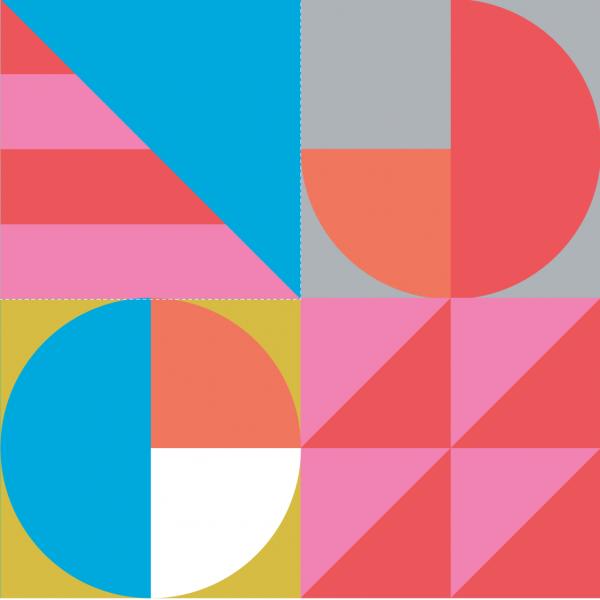Medizin muss unternehmerisch denken. Darüber sind sich die meisten Experten einig. Die Frage, in welchem Ausmaß das geschehen darf, führt jedoch zu konträren Standpunkten.
„Nichts ist dem Menschen so kostbar wie seine Gesundheit.“ Mag dieser vielzitierte Satz stimmen oder nicht: Fakt ist, dass ein gut funktionierendes Gesundheitssystem zu den wichtigsten Aufgaben eines Staates gehört – gleichzeitig aber auch zu den kostspieligsten. Dieses Gut gelte es in Zukunft zu bewahren, sagt Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer in Oberösterreich und klagt über die Sparmaßnahmen, die sich in Zukunft negativ auf medizinische Leistungen auswirken werden. Ökonomisches Handeln im medizinischen Bereich sei notwendig, um das System auch für die kommenden Generationen sicherzustellen, erwidert Landeshauptmann Josef Pühringer. Die Fronten zwischen Politik und Ärztekammer wirken verhärtet. Die Gratwanderung auf der Suche nach Konsens scheint auf Wegen zu verlaufen, die immer wieder zwischen Mythen und Fakten neu entdeckt werden müssen.
Betrachtet man die Anzahl der Betten in den österreichischen Krankenhäusern, so kann in den letzten 30 Jahren ein eindeutiger Rückgang festgestellt werden. Mehr als 75.000 Betten gab es vor 30 Jahren in Österreichs Spitälern. Rund 10.000 Betten weniger standen den Patienten in Österreich im Jahr 2015 zur Verfügung. Auch die Anzahl der Anstalten verringerte sich parallel dazu. 300 Krankenanstalten gab es im Jahr 1985, 278 im Jahr 2015. Konträr dazu lässt sich jedoch die demographische Entwicklung verfolgen: Im Jahr 2015 lebten in Österreich eine Million Menschen mehr als 1975. Dies ist nur ein Bereich, den Niedermoser kritisiert: „Der ökonomische Druck schlägt sich schon oft auf die medizinischen Leistungen nieder.“ Vonseiten der Politik werde behauptet, es werde alles besser und effizienter und das bei weniger Ausgaben für die Medizin. „Fakt ist jedoch, dass sich diese ökonomischen Zwänge bei den Leistungen bemerkbar machen.“ Landeshauptmann Pühringer sieht in der reduzierten Bettenanzahl in den Krankenhäusern Oberösterreichs keinen Grund zur Beunruhigung. Im Jahr 2012 habe es eine Gesundheitsreform gegeben, die zum Ziel hatte, die sogenannte Primärversorgung auszubauen, sagt Pühringer: „Viele medizinische Leistungen, die bisher mit stationären Aufenthalten verbunden waren, können heute tagesklinisch erbracht werden.“ Dies führe zu einer Reduktion stationärer Aufenthalte. Zudem sei Österreich trotz sinkender Zahl von Krankenhausbetten im internationalen Vergleich an vorderer Stelle. „Österreich hat pro tausend Einwohner 60 Prozent mehr Spitalsbetten als der Durchschnitt aller OECD-Länder“, äußert sich der Landeshauptmann. Aus diesem Grund werden auch Primärversorgungszentren mit multiprofessionellen Teams und längeren Öffnungszeiten vonseiten der Politik forciert. Somit können Patienten außerhalb der Krankenhäuser betreut werden und die Ressourcen der Spitäler müssen nicht beansprucht werden. Ab Jänner 2017 starte ein derartiges Zentrum in Enns, im darauffolgenden Jahr solle ein weiteres in Haslach errichtet werden.
Höher, schneller, weiter?
Dietbert Timmerer, Geschäftsführer des Klinikums Wels-Grieskirchen, verspricht seinen Patienten „durchgängige Effizienz in der Leistungserbringung“, auch wenn die knapper werdenden finanziellen Möglichkeiten eine Herausforderung an das Management von Kliniken darstellen. Das Ordensspital machte in den letzten Jahren immer wieder mit diversen Auszeichnungen wie den Staatspreis für Familienfreundlichkeit, Qualitätszertifikaten oder wissenschaftlichen Preisen in der Tumorforschung auf sich aufmerksam. Für die Qualität der angebotenen Dienste bürgt das Leitbild, in denen sich das Klinikum Wels-Grieskirchen unter anderem verpflichtet, die hohe Qualität der Leistungen zu sichern und dabei auf den sorgsamen Umgang mit den anvertrauten Gütern und Ressourcen zu achten. Den engen ordnungspolitischen Rahmen müsse man ernst nehmen, sagt Timmerer: „Das Klinikum Wels-Grieskirchen ist dabei bemüht, die Investitionen und Projekte zukunftssicher und innovativ zu managen.“ Ziel des Handelns sei es, am Puls der technologischen Entwicklungen zu sein und den Patienten ein Höchstmaß an Behandlungs-, Diagnose- und Therapiequalität zukommen zu lassen. „Unternehmerisches Denken ist in diesem Sinne nichts Negatives“, so der Geschäftsführer.
Das Personal der oberösterreichischen Krankenhäuser sei, wie immer wieder in der Öffentlichkeit gemunkelt wird, nicht von diesen unternehmerischen Gedanken und den Sparmaßnahmen betroffen, äußert sich Pühringer. Im Gegenteil: „Im Zeitraum von 2000 bis 2015 wurden in Oberösterreich über 2.400 zusätzliche Ärzte- und Pflegepersonalstellen geschaffen,“ antwortet der Landeshauptmann auf die Forderungen der Ärztekammer, die Politik solle doch wieder mehr in die Mitarbeiter eines Krankenhauses investieren. Als viel zu wenig für die Menge der Aufgaben, die ein Arzt heutzutage zu bewältigen hat, bezeichnet Niedermoser diesen Zuwachs an Personal und verweist auf die zahlreichen Anforderungen an Ärzte. Der Umgang mit den Erkrankungen sei zeitintensiver geworden, die Therapien aufwendiger, die Patienten fordern mehr Zuwendung. „Um nur ein Beispiel zu nennen: Früher wurden manchmal Narkosen vom Pflegepersonal durchgeführt, jetzt aus Qualitätsgründen von Ärzten.“ Zeit sei für Patienten das Wichtigste, was man ihnen schenken könne. „Patienten brauchen vor dem Krankenbett in erster Linie Menschen und keine Maschinen“, sagt der Präsident der Ärztekammer. „Sie benötigen Menschen zum Reden. Am wichtigsten sind somit Pflegekräfte und Ärzte.“ Die zahlreichen neuen Anforderungen führen oft zu einer enormen Belastung bei den Ärzten. Dazu gehören unter anderem der Mangel an Zeit, die benötigt wird, um bestimmte Aufgaben zu verrichten sowie der Druck, gute Arbeit immer schneller zu verrichten, erklärt Niedermoser. Damit Ärzte jedoch weiterhin die ausgezeichneten Leistungen erbringen können, sei es notwendig, sie durch weiteres Personal zu entlasten. Dabei dürfe nicht gespart werden. „Wenn man Ressourcen einschränkt, führt das zu einer Leistungsverminderung, egal in welchen Bereichen. Darüber muss sich die Politik im Klaren sein.“ Dass Ärzte aufgrund ihrer Tätigkeit starken Belastungen ausgesetzt sind, zeigen etliche Studien, die das Burn-out-Syndrom nach Berufsgruppen ordnen. Menschen, die in der Gesundheits- und Krankenpflege arbeiten, stehen dabei immer an erster Stelle.
Die Leistungsminderung, von der Niedermoser spricht, lässt sich nicht in den aktuellen Werten einer im September 2016 durchgeführten Umfrage feststellen. Pühringer verweist darauf, dass darin über 90 Prozent der Oberösterreicher mit der Kompetenz des Pflegepersonals und der medizinischen Versorgung „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ waren. Für Niedermoser ist das kein Widerspruch. „Weshalb alles noch so gut funktioniert, liegt daran, dass Ärzte ein sehr hohes ethisches Bewusstsein haben. Solange jedoch dieses System noch aufrecht ist, wird vonseiten der Politik nichts passieren.“